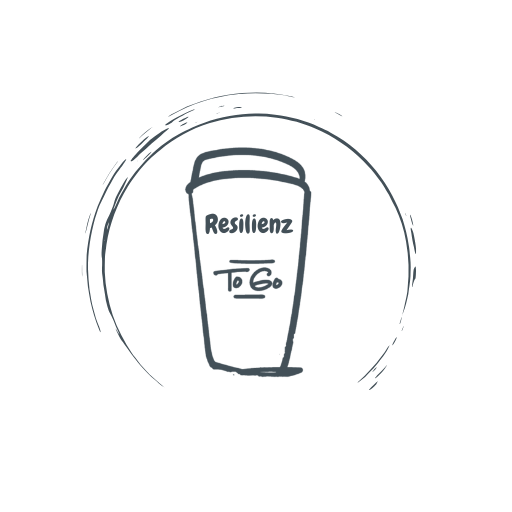Verantwortung zu übernehmen ist ein zentrales Element jeder Resilienzstrategie. Es geht dabei nicht um Schuld, sondern um die bewusste Entscheidung, das eigene Handeln aktiv zu gestalten. Menschen, die Verantwortung übernehmen, fühlen sich weniger ausgeliefert und erleben sich als wirksam. Ein Zustand, den die Psychologie als Selbstwirksamkeit bezeichnet.
Die Fähigkeit, in herausfordernden Situationen Verantwortung zu übernehmen, entlastet nicht nur das Nervensystem, sondern stärkt nachweislich die psychische Widerstandskraft. Albert Bandura, einer der einflussreichsten Psychologen des 20. Jahrhunderts, beschreibt Selbstwirksamkeit als den Glauben an die eigene Fähigkeit, schwierige Situationen erfolgreich zu bewältigen.
Verantwortung vs. Schuld – ein entscheidender Unterschied
Viele Menschen verwechseln Verantwortung mit Schuldzuweisung. Schuld ist rückwärtsgerichtet und bindet Energie in der Frage „Wer ist schuld?“. Verantwortung hingegen ist zukunftsorientiert: „Was kann ich jetzt tun, um die Situation zu verbessern?“
Diese Verschiebung im Fokus wirkt direkt auf das Gehirn. Während Schuldgefühle häufig den Stressmodus aktivieren und den präfrontalen Kortex – das Zentrum für Planung und Entscheidungen – blockieren, öffnet Verantwortung den Zugang zu kreativen Lösungen und handlungsorientiertem Denken.
Selbstwirksamkeit und das Gehirn
Selbstwirksamkeit ist eng mit der Neuroplastizität des Gehirns verbunden. Studien zeigen, dass das Gefühl, Kontrolle über das eigene Handeln zu haben, neuronale Netzwerke stärkt, die für Motivation, Problemlösung und Emotionsregulation zuständig sind.
Ein reguliertes Nervensystem – wie es im NeuroEmbodiment trainiert wird – bildet die Grundlage dafür. Nur wenn der Körper sich sicher fühlt, ist das Gehirn bereit, in lösungsorientierte und strategische Denkprozesse einzusteigen.
Verantwortung macht das Gehirn fitter
Verantwortung zu übernehmen, ist auch ein Training für die kognitive Flexibilität. Wer aktiv entscheidet, anstatt passiv zu reagieren, fordert das Gehirn heraus, neue Denkwege zu entwickeln. Dieser Prozess stimuliert synaptische Verbindungen und kann langfristig die Gehirnfitness verbessern.
Beispielsweise in Unternehmen zeigt sich: Mitarbeitende, die Eigenverantwortung leben, handeln proaktiver, entwickeln mehr Ideen und zeigen höhere Stressresistenz. Im privaten Alltag führt Eigenverantwortung zu einer größeren inneren Stabilität. Selbst in unsicheren Zeiten.
Praxisbeispiele
- Im Team: Anstatt auf Vorgaben zu warten, proaktiv Vorschläge einbringen und Verantwortung für die Umsetzung übernehmen.
- Im Projekt: Probleme nicht nur benennen, sondern konkrete Lösungen erarbeiten.
- Im Stressmanagement: Frühzeitig erkennen, welche Faktoren beeinflussbar sind, und dort aktiv ansetzen, anstatt sich auf Unveränderliches zu fokussieren.
Strategien zur Stärkung von Eigenverantwortung
- Klarheit über Einflussbereich – unterscheiden zwischen dem, was verändert werden kann, und dem, was akzeptiert werden muss.
- Reframing – Probleme als Aufgaben formulieren, für die es Lösungen gibt.
- Kleine, messbare Schritte setzen – Erfolge sichtbar machen, um das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu verstärken.
- Somatische Regulation – Atemübungen, Embodiment-Methoden oder Bewegung, um den Körper in einen ressourcenreichen Zustand zu bringen.
Fazit Verantwortung zu übernehmen bedeutet, aktiv in den Gestaltungsmodus zu wechseln. Dieser Schritt ist entscheidend für Resilienz, weil er Handlungsfähigkeit stärkt, das Nervensystem entlastet und das Gehirn langfristig trainiert.
Wer Verantwortung als Chance begreift, entwickelt nicht nur mehr innere Stärke, sondern erhöht auch die eigene Selbstwirksamkeit – im Beruf und im Alltag.