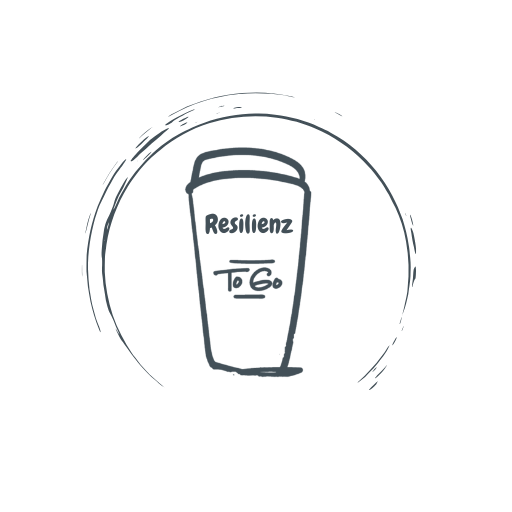Akzeptanz gilt in der Resilienzforschung als eine der zentralen Fähigkeiten, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Sie bedeutet nicht, passiv zu werden oder aufzugeben, sondern die Realität in ihrer jetzigen Form anzuerkennen, um von dort aus handlungsfähig zu bleiben. Ohne Akzeptanz bleibt man oft im Widerstand gefangen. Ein Zustand, der das Nervensystem dauerhaft in Alarmbereitschaft hält und die kognitive Leistungsfähigkeit einschränkt.
In der Polyvagal-Theorie zeigt sich, dass das Festhalten am Widerstand den Sympathikus dauerhaft aktiviert. Das kostet Energie, führt zu Anspannung und kann die Fähigkeit zu klaren Entscheidungen blockieren. Erst wenn der innere Kampf gegen das „Was ist“ beendet wird, kann sich das Nervensystem regulieren, was wiederum die Basis für neue Lösungen schafft.
Akzeptanz im Alltag – ein Beispiel
Ein Projekt im Unternehmen gerät ins Stocken, weil ein wichtiger Kunde abspringt. Die erste Reaktion vieler Menschen: Ärger, Schuldzuweisungen oder ein Festhalten an der ursprünglichen Planung. Diese Reaktion bindet Energie und verzögert eine konstruktive Neuorientierung.
Akzeptanz bedeutet hier nicht, den Verlust gutzuheißen, sondern anzuerkennen, dass er geschehen ist. Erst dann können Ressourcen frei werden, um über Alternativen, neue Kundensegmente oder strategische Anpassungen nachzudenken.
Wissenschaftliche Perspektive
Studien aus der positiven Psychologie (z. B. Kashdan & Rottenberg, 2010) zeigen, dass Akzeptanz eng mit psychischer Flexibilität verbunden ist. Menschen mit einer hohen Akzeptanzfähigkeit können schneller zwischen verschiedenen Denk- und Handlungsstrategien wechseln. Diese kognitive Flexibilität ist entscheidend für Resilienz. Sowohl im privaten Alltag als auch im Unternehmenskontext.
Im NeuroEmbodiment-Ansatz wird Akzeptanz auch körperlich verankert. Durch gezielte somatische Übungen lässt sich die Stressreaktion regulieren, sodass der präfrontale Kortex – der Teil des Gehirns, der für rationales Denken und kreative Problemlösung zuständig ist – wieder aktiv arbeiten kann.
Praxisorientierte Umsetzung
Akzeptanz lässt sich trainieren, indem regelmäßig reflektiert wird:
- Benennen, was ist – präzise und ohne Bewertung.
- Emotionen zulassen – körperlich spüren, ohne sofort zu handeln.
- Bewusst entscheiden, was als Nächstes möglich ist – ausgehend von den aktuellen Gegebenheiten.
Im Resilienztraining kann Akzeptanz durch Achtsamkeit, Atemarbeit oder kurze Reflexionsroutinen gestärkt werden. Besonders wirksam ist die Verbindung von kognitiver Einsicht (hier gibt es gezielte Übungen, die unser Bewusstsein trainieren) mit körperorientierten Methoden aus dem NeuroEmbodiment, um die Fähigkeit des Nervensystems zur Regulation zu fördern.
Fazit
Akzeptanz ist kein passives Erdulden, sondern die Voraussetzung für aktive Gestaltung. Wer aufhört, gegen unveränderliche Gegebenheiten zu kämpfen, entlastet das Nervensystem, erhöht die Handlungsfähigkeit und schafft Raum für kreative, lösungsorientierte Schritte.